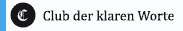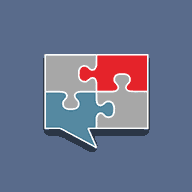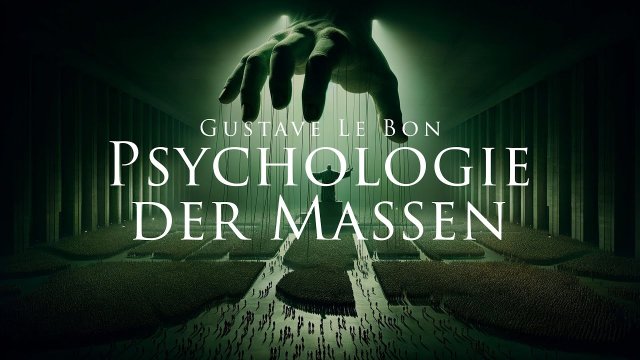- Registriert
- 7 Aug 2008
- Zuletzt online:
- Beiträge
- 1.576
- Punkte Reaktionen
- 30
- Punkte
- 0
- Geschlecht
- --
- Thread Starter
- #21
Im Streit zwischen den politischen Lagern spielte nun der in Paris seit Januar 1844 erscheinende „Vorwärts!“ eine wichtige Rolle, über dessen Hintergründe wir durch Mehring gleich gehörig aufgeklärt werden:
In Paris erschien seit Neujahr 1844, zweimal in der Woche, der »Vorwärts!«, der nicht eben den feinsten Ursprung hatte. Ein gewisser Heinrich Börnstein, der in Theater- und sonstigen Reklamegeschäften machte, hatte ihn für die Zwecke seines Geschäftsbetriebs gegründet, und zwar mit einem reichlichen Trinkgelde, das ihm der Komponist Meyerbeer gespendet hatte; man weiß ja aus Heine, wie sehr dieser königlich-preußische Generalmusikdirektor, der mit Vorliebe in Paris lebte, auf eine weitverzweigte Reklame versessen und auch wohl angewiesen war. Als geriebener Geschäftsmann hing Börnstein dem »Vorwärts!« aber ein patriotisches Mäntelchen um und ließ das Blatt von Adalbert von Bornstedt redigieren, einem ehemals preußischen Offizier und nunmehrigen Allerweltsspitzel, der sowohl »Konfident« Metternichs war als auch von der Berliner Regierung bezahlt wurde. In der Tat wurden die »Deutsch-Französischen Jahrbücher« sofort nach ihrem Erscheinen vom »Vorwärts!« mit einer Schimpfsalve begrüßt, von der schwer zu sagen ist, ob sie alberner oder pöbelhafter war.
Bei alledem aber wollte das Geschäft nicht glücken. Im Interesse einer fingerfertigen Übersetzungsfabrik, die Börnstein eingerichtet hatte, um neue Stücke der Pariser Bühne mit unglaublicher Fixigkeit an die deutschen Theaterdirektionen zu vertreiben, mußte er die jungdeutschen Dramatiker auszustechen suchen, und wieder, um diesen Zweck bei den nun einmal rebellisch gewordenen Spießern zu erreichen, mußte er einiges vom »gemäßigten Fortschritt« faseln und dem »Ultrawesen« nicht nur nach links, sondern auch nach rechts absagen. In derselben Notwendigkeit befand sich Bornstedt, wenn er die Flüchtlingskreise nicht kopfscheu machen wollte, in denen unverdächtig zu verkehren ja die Vorbedingung seines Sündensoldes war. Allein die preußische Regierung war so verblendet, daß sie ihre eigenen staatsretterischen Notwendigkeiten nicht begriff und den »Vorwärts!« in ihren Staaten verbot, worauf andere deutsche Regierungen das gleiche taten.
(Mehring, ebenda)
Man kann sicher annehmen, Mehring hat alles gewusst. Sobald es nicht direkt Marx betrifft, geht Mehring ohne Scheu und deutlichst zur Sache. Bei Marx pflegt er aber fast immer so tun, als wäre er von diesem „großen Revolutionär“ noch selber schwer beeindruckt gewesen.
An einigen Stellen müssen wir aber zwischen den Zeilen lesen, wie am Beispiel des oben zuletzt zitierten Satzes.
Allein die preußische Regierung war so verblendet, daß sie ihre eigenen staatsretterischen Notwendigkeiten nicht begriff und den »Vorwärts!« in ihren Staaten verbot, worauf andere deutsche Regierungen das gleiche taten.
Das Verbot des „Vorwärts!“ durch die preußische Regierung sollte nämlich eine wichtige Veränderung in Redaktion und Haltung des Blattes auslösen und ich kann nicht glauben, dass Mehring den Zusammenhang so schön dokumentiert, aber selber nicht begriffen habe. Die angeblich verblendete Entscheidung der preußischen Regierung führte zu folgenden Konsequenzen (wieder Mehring):
Bornstedt gab nun das Spiel im Anfang Mai als hoffnungslos auf, aber nicht so Börnstein. Er wollte seine Geschäfte machen, so oder so, und sagte sich mit der Kaltblütigkeit eines geriebenen Spekulanten, daß der »Vorwärts!«, wenn er nun einmal in Preußen verboten bleiben solle, auch alle Würze eines verbotenen Blattes erhalten müsse, so daß es dem preußischen Spießbürger lohne, ihn auf Schleichwegen zu beziehen. Es war ihm deshalb sehr willkommen, als ihm der jugendliche Heißsporn Bernays einen gepfefferten Artikel für den »Vorwärts!« anbot, und nach einigem Geplänkel erhielt Bernays die redaktionelle Leitung des Blatts an der Stelle Bornstedts. Nunmehr beteiligten sich auch andere Flüchtlinge am »Vorwärts!«, aus jeglichem Mangel an einem andern Organ, unabhängig von der Redaktion und jeder auf eigene Verantwortung.
Es kam natürlich wieder zu Streit zwischen Marx und Ruge, der angeblich durch Ruge veranlasst worden sei.
Unter den ersten befand sich Ruge. Auch er plänkelte erst unter seinem Namen mit Börnstein, wobei er sogar, als wäre er noch völlig einverstanden mit Marx, dessen Aufsätze in den »Deutsch-Französischen Jahrbüchern« er verteidigte. Ein paar Monate darauf veröffentlichte er zwei neue Artikel, ein paar kurze Bemerkungen über die preußische Politik und einen langen Klatschartikel über die preußische Dynastie, worin vom »trinkenden König« und der »hinkenden Königin«, von ihrer »rein spirituellen« Ehe usw. gesprochen wurde, beide aber nicht mehr unter seinem Namen, sondern mit der Unterschrift: Ein Preuße, was auf Marx als Verfasser hindeutete.
(Mehring, ebenda)
Was mich nicht überzeugt, denn Rheinländer sind keine Preußen und den auf Rügen geborenen Ruge nach einem seiner letzten Aufenthalte als Sachsen zu bezeichnen, ist an den Haaren herbei gezogen. Aber der nun von Marx folgende Angriff gegen Ruge im „Vorwärts!“ soll damit begründet sein.
In der Sache handelte es sich um den schlesischen Weberaufstand von 1844, den Ruge als eine gleichgültige Sache behandelt hatte; ihm habe die politische Seele gefehlt und ohne eine politische Seele sei eine soziale Revolution unmöglich. Was Marx dagegen einwandte, hatte er im Grunde schon im Aufsatze zur Judenfrage gesagt. Die politische Gewalt kann keine sozialen Übel heilen, weil der Staat nicht Zustände aufheben kann, deren Produkt er ist.
Was im letzten Satz so tief philosophisch daherkommt, ist ein für die praktischen Interessen der Arbeiter ganz heimtückische Fallgrube von Marx. Behauptet er damit doch allen Ernstes, dass der Staat zur Besserung der sozialen Zustände grundsätzlich nicht fähig wäre.
Das ist die Linie, auf der später Ferdinand Lassalle mit seinem „ehernen Lohngesetz“ dem Publikum einreden wird, dass Gewerkschaften zur Hebung der Löhne nicht imstande seien, weil die Löhne immer nach seinem „ehernen Lohngesetz“ um das Existenzminimum schwanken müssten.
Marx wandte sich scharf gegen den Utopismus, indem er sagte, daß sich der Sozialismus nicht ohne Revolution ausführen lasse, aber er wandte sich nicht minder scharf gegen den Blanquismus, indem er ausführte, daß der politische Verstand den sozialen Instinkt betrüge, wenn er durch kleine nutzlose Putsche vorwärts zu kommen suche. Mit epigrammatischer Schärfe erklärte Marx das Wesen der Revolution: »jede Revolution löst die alte Gesellschaft auf; insofern ist sie sozial. Jede Revolution stürzt die alte Gewalt; insofern ist sie politisch.« Die soziale Revolution mit einer politischen Seele, die Ruge verlange, sei sinnlos, dagegen vernünftig sei eine politische Revolution mit einer sozialen Seele.
Das bekannte Geschwalle, das letztlich nur die Leute spalten und jeden abwerten soll, der irgendwo etwas gegen die herrschenden Verhältnisse zu unternehmen beabsichtigt, jeweils zur Not pseudophilosophisch begründet.
Die allseitige Teilnahme für die Weber machte Marx gegen die Unterschätzung des Aufstandes durch Ruge geltend, »aber der geringe Widerstand der Bourgeoisie gegen soziale Tendenzen und Ideen« täuschte ihn nun doch nicht. Er sah voraus, daß die Arbeiterbewegung die politischen Antipathien und Gegensätze innerhalb der herrschenden Klassen ersticken und die ganze Feindschaft der Politik gegen sich lenken werde, sobald sie eine entschiedene Macht erlangt habe. Marx deckte den tiefsten Unterschied zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Emanzipation auf, indem er jene als ein Produkt gesellschaftlichen Wohlbefindens, diese als ein Produkt gesellschaftlicher Not nachwies.
(Mehring, ebenda)
Hirnerweichend, aber Ruge ist Marx wichtiger als alle Weber.
Die Isolierung vom politischen Gemein-, vom Staatswesen sei die Ursache der bürgerlichen, die Isolierung vom menschlichen Wesen, vom wahren Gemeinwesen des Menschen, sei die Ursache der proletarischen Revolution. Wie die Isolierung von diesem Wesen unverhältnismäßig allseitiger, unerträglicher, fürchterlicher, widerspruchsvoller sei als die Isolierung vom politischen Gemeinwesen, so sei ihre Aufhebung, selbst als partielle Erscheinung wie in dem schlesischen Weberaufstande, um so viel unendlicher, wie der Mensch unendlicher sei als der Staatsbürger und das menschliche Leben als das politische Leben.
Wer so formuliert, ist der richtige Mann als großer Vordenker der politischen Organisation der Arbeiterklasse – für Regierung und Polizei im Kapitalismus. Wer noch nicht durch die herrschenden Verhältnisse um den Verstand gebracht wurde, wird es mit solchem hegelianischen Geschwurbel zuletzt doch noch.
In Auszügen:
Hieraus ergibt sich, daß Marx über diesen Aufstand ganz anders urteilte als Ruge…
Im Anschluß daran erinnerte Marx an die genialen Schriften Weitlings…
Womit wir bei den auf Ruge, Herwegh und Bakunin folgenden Opfern des frühen „Marxismus“ wären:
Die »anderthalb Handwerksburschen«, auf die Ruge verächtlich herabsah, während Marx sie eifrig studierte, waren im Bunde der Gerechten organisiert, der sich während der dreißiger Jahre im Anschluß an die französischen Geheimbünde entwickelt hatte und in deren letzte Niederlage im Jahre 1839 verwickelt worden war. Es war ihm insofern zum Heil gewesen, als sich seine versprengten Elemente nicht nur in dem alten Mittelpunkte Paris wieder gesammelt, sondern auch den Bund nach England und der Schweiz verbreitet hatten, wo ihm die Vereins- und Versammlungsfreiheit breiteren Spielraum bot, so daß diese Absenker sich kräftiger entwickelten als der alte Stamm. Die Pariser Organisation stand unter der Leitung des Danzigers Hermann Ewerbeck, der, wie er Cabets Utopie ins Deutsche übersetzte, auch noch in Cabets moralisierendem Utopismus befangen war. Ihm geistig überlegen erwies sich Weitling, der die Agitation in der Schweiz leitete, und mindestens an revolutionärer Entschlossenheit wurde Ewerbeck auch durch die Londoner Führer des Bundes übertroffen, den Uhrmacher Josef Moll, den Schuhmacher Heinrich Bauer und Karl Schapper, einen ehemaligen Studenten der Forstwissenschaft, der sich bald als Schriftsetzer, bald als Sprachlehrer durchs Leben schlug.
(Mehring, ebenda)
Die Genannten werden bald alle selbst den Hass des Karl Marx und seine Zerstörungswut gegenüber ihrer erfolgreichen Organisation zu spüren bekommen. Mit der Kritik an Hermann Ewerbeck in Paris ging es ja schon los, als Weitling von Marx noch über den grünen Klee gelobt wurde.
In Paris erschien seit Neujahr 1844, zweimal in der Woche, der »Vorwärts!«, der nicht eben den feinsten Ursprung hatte. Ein gewisser Heinrich Börnstein, der in Theater- und sonstigen Reklamegeschäften machte, hatte ihn für die Zwecke seines Geschäftsbetriebs gegründet, und zwar mit einem reichlichen Trinkgelde, das ihm der Komponist Meyerbeer gespendet hatte; man weiß ja aus Heine, wie sehr dieser königlich-preußische Generalmusikdirektor, der mit Vorliebe in Paris lebte, auf eine weitverzweigte Reklame versessen und auch wohl angewiesen war. Als geriebener Geschäftsmann hing Börnstein dem »Vorwärts!« aber ein patriotisches Mäntelchen um und ließ das Blatt von Adalbert von Bornstedt redigieren, einem ehemals preußischen Offizier und nunmehrigen Allerweltsspitzel, der sowohl »Konfident« Metternichs war als auch von der Berliner Regierung bezahlt wurde. In der Tat wurden die »Deutsch-Französischen Jahrbücher« sofort nach ihrem Erscheinen vom »Vorwärts!« mit einer Schimpfsalve begrüßt, von der schwer zu sagen ist, ob sie alberner oder pöbelhafter war.
Bei alledem aber wollte das Geschäft nicht glücken. Im Interesse einer fingerfertigen Übersetzungsfabrik, die Börnstein eingerichtet hatte, um neue Stücke der Pariser Bühne mit unglaublicher Fixigkeit an die deutschen Theaterdirektionen zu vertreiben, mußte er die jungdeutschen Dramatiker auszustechen suchen, und wieder, um diesen Zweck bei den nun einmal rebellisch gewordenen Spießern zu erreichen, mußte er einiges vom »gemäßigten Fortschritt« faseln und dem »Ultrawesen« nicht nur nach links, sondern auch nach rechts absagen. In derselben Notwendigkeit befand sich Bornstedt, wenn er die Flüchtlingskreise nicht kopfscheu machen wollte, in denen unverdächtig zu verkehren ja die Vorbedingung seines Sündensoldes war. Allein die preußische Regierung war so verblendet, daß sie ihre eigenen staatsretterischen Notwendigkeiten nicht begriff und den »Vorwärts!« in ihren Staaten verbot, worauf andere deutsche Regierungen das gleiche taten.
(Mehring, ebenda)
Man kann sicher annehmen, Mehring hat alles gewusst. Sobald es nicht direkt Marx betrifft, geht Mehring ohne Scheu und deutlichst zur Sache. Bei Marx pflegt er aber fast immer so tun, als wäre er von diesem „großen Revolutionär“ noch selber schwer beeindruckt gewesen.
An einigen Stellen müssen wir aber zwischen den Zeilen lesen, wie am Beispiel des oben zuletzt zitierten Satzes.
Allein die preußische Regierung war so verblendet, daß sie ihre eigenen staatsretterischen Notwendigkeiten nicht begriff und den »Vorwärts!« in ihren Staaten verbot, worauf andere deutsche Regierungen das gleiche taten.
Das Verbot des „Vorwärts!“ durch die preußische Regierung sollte nämlich eine wichtige Veränderung in Redaktion und Haltung des Blattes auslösen und ich kann nicht glauben, dass Mehring den Zusammenhang so schön dokumentiert, aber selber nicht begriffen habe. Die angeblich verblendete Entscheidung der preußischen Regierung führte zu folgenden Konsequenzen (wieder Mehring):
Bornstedt gab nun das Spiel im Anfang Mai als hoffnungslos auf, aber nicht so Börnstein. Er wollte seine Geschäfte machen, so oder so, und sagte sich mit der Kaltblütigkeit eines geriebenen Spekulanten, daß der »Vorwärts!«, wenn er nun einmal in Preußen verboten bleiben solle, auch alle Würze eines verbotenen Blattes erhalten müsse, so daß es dem preußischen Spießbürger lohne, ihn auf Schleichwegen zu beziehen. Es war ihm deshalb sehr willkommen, als ihm der jugendliche Heißsporn Bernays einen gepfefferten Artikel für den »Vorwärts!« anbot, und nach einigem Geplänkel erhielt Bernays die redaktionelle Leitung des Blatts an der Stelle Bornstedts. Nunmehr beteiligten sich auch andere Flüchtlinge am »Vorwärts!«, aus jeglichem Mangel an einem andern Organ, unabhängig von der Redaktion und jeder auf eigene Verantwortung.
Es kam natürlich wieder zu Streit zwischen Marx und Ruge, der angeblich durch Ruge veranlasst worden sei.
Unter den ersten befand sich Ruge. Auch er plänkelte erst unter seinem Namen mit Börnstein, wobei er sogar, als wäre er noch völlig einverstanden mit Marx, dessen Aufsätze in den »Deutsch-Französischen Jahrbüchern« er verteidigte. Ein paar Monate darauf veröffentlichte er zwei neue Artikel, ein paar kurze Bemerkungen über die preußische Politik und einen langen Klatschartikel über die preußische Dynastie, worin vom »trinkenden König« und der »hinkenden Königin«, von ihrer »rein spirituellen« Ehe usw. gesprochen wurde, beide aber nicht mehr unter seinem Namen, sondern mit der Unterschrift: Ein Preuße, was auf Marx als Verfasser hindeutete.
(Mehring, ebenda)
Was mich nicht überzeugt, denn Rheinländer sind keine Preußen und den auf Rügen geborenen Ruge nach einem seiner letzten Aufenthalte als Sachsen zu bezeichnen, ist an den Haaren herbei gezogen. Aber der nun von Marx folgende Angriff gegen Ruge im „Vorwärts!“ soll damit begründet sein.
In der Sache handelte es sich um den schlesischen Weberaufstand von 1844, den Ruge als eine gleichgültige Sache behandelt hatte; ihm habe die politische Seele gefehlt und ohne eine politische Seele sei eine soziale Revolution unmöglich. Was Marx dagegen einwandte, hatte er im Grunde schon im Aufsatze zur Judenfrage gesagt. Die politische Gewalt kann keine sozialen Übel heilen, weil der Staat nicht Zustände aufheben kann, deren Produkt er ist.
Was im letzten Satz so tief philosophisch daherkommt, ist ein für die praktischen Interessen der Arbeiter ganz heimtückische Fallgrube von Marx. Behauptet er damit doch allen Ernstes, dass der Staat zur Besserung der sozialen Zustände grundsätzlich nicht fähig wäre.
Das ist die Linie, auf der später Ferdinand Lassalle mit seinem „ehernen Lohngesetz“ dem Publikum einreden wird, dass Gewerkschaften zur Hebung der Löhne nicht imstande seien, weil die Löhne immer nach seinem „ehernen Lohngesetz“ um das Existenzminimum schwanken müssten.
Marx wandte sich scharf gegen den Utopismus, indem er sagte, daß sich der Sozialismus nicht ohne Revolution ausführen lasse, aber er wandte sich nicht minder scharf gegen den Blanquismus, indem er ausführte, daß der politische Verstand den sozialen Instinkt betrüge, wenn er durch kleine nutzlose Putsche vorwärts zu kommen suche. Mit epigrammatischer Schärfe erklärte Marx das Wesen der Revolution: »jede Revolution löst die alte Gesellschaft auf; insofern ist sie sozial. Jede Revolution stürzt die alte Gewalt; insofern ist sie politisch.« Die soziale Revolution mit einer politischen Seele, die Ruge verlange, sei sinnlos, dagegen vernünftig sei eine politische Revolution mit einer sozialen Seele.
Das bekannte Geschwalle, das letztlich nur die Leute spalten und jeden abwerten soll, der irgendwo etwas gegen die herrschenden Verhältnisse zu unternehmen beabsichtigt, jeweils zur Not pseudophilosophisch begründet.
Die allseitige Teilnahme für die Weber machte Marx gegen die Unterschätzung des Aufstandes durch Ruge geltend, »aber der geringe Widerstand der Bourgeoisie gegen soziale Tendenzen und Ideen« täuschte ihn nun doch nicht. Er sah voraus, daß die Arbeiterbewegung die politischen Antipathien und Gegensätze innerhalb der herrschenden Klassen ersticken und die ganze Feindschaft der Politik gegen sich lenken werde, sobald sie eine entschiedene Macht erlangt habe. Marx deckte den tiefsten Unterschied zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Emanzipation auf, indem er jene als ein Produkt gesellschaftlichen Wohlbefindens, diese als ein Produkt gesellschaftlicher Not nachwies.
(Mehring, ebenda)
Hirnerweichend, aber Ruge ist Marx wichtiger als alle Weber.
Die Isolierung vom politischen Gemein-, vom Staatswesen sei die Ursache der bürgerlichen, die Isolierung vom menschlichen Wesen, vom wahren Gemeinwesen des Menschen, sei die Ursache der proletarischen Revolution. Wie die Isolierung von diesem Wesen unverhältnismäßig allseitiger, unerträglicher, fürchterlicher, widerspruchsvoller sei als die Isolierung vom politischen Gemeinwesen, so sei ihre Aufhebung, selbst als partielle Erscheinung wie in dem schlesischen Weberaufstande, um so viel unendlicher, wie der Mensch unendlicher sei als der Staatsbürger und das menschliche Leben als das politische Leben.
Wer so formuliert, ist der richtige Mann als großer Vordenker der politischen Organisation der Arbeiterklasse – für Regierung und Polizei im Kapitalismus. Wer noch nicht durch die herrschenden Verhältnisse um den Verstand gebracht wurde, wird es mit solchem hegelianischen Geschwurbel zuletzt doch noch.
In Auszügen:
Hieraus ergibt sich, daß Marx über diesen Aufstand ganz anders urteilte als Ruge…
Im Anschluß daran erinnerte Marx an die genialen Schriften Weitlings…
Womit wir bei den auf Ruge, Herwegh und Bakunin folgenden Opfern des frühen „Marxismus“ wären:
Die »anderthalb Handwerksburschen«, auf die Ruge verächtlich herabsah, während Marx sie eifrig studierte, waren im Bunde der Gerechten organisiert, der sich während der dreißiger Jahre im Anschluß an die französischen Geheimbünde entwickelt hatte und in deren letzte Niederlage im Jahre 1839 verwickelt worden war. Es war ihm insofern zum Heil gewesen, als sich seine versprengten Elemente nicht nur in dem alten Mittelpunkte Paris wieder gesammelt, sondern auch den Bund nach England und der Schweiz verbreitet hatten, wo ihm die Vereins- und Versammlungsfreiheit breiteren Spielraum bot, so daß diese Absenker sich kräftiger entwickelten als der alte Stamm. Die Pariser Organisation stand unter der Leitung des Danzigers Hermann Ewerbeck, der, wie er Cabets Utopie ins Deutsche übersetzte, auch noch in Cabets moralisierendem Utopismus befangen war. Ihm geistig überlegen erwies sich Weitling, der die Agitation in der Schweiz leitete, und mindestens an revolutionärer Entschlossenheit wurde Ewerbeck auch durch die Londoner Führer des Bundes übertroffen, den Uhrmacher Josef Moll, den Schuhmacher Heinrich Bauer und Karl Schapper, einen ehemaligen Studenten der Forstwissenschaft, der sich bald als Schriftsetzer, bald als Sprachlehrer durchs Leben schlug.
(Mehring, ebenda)
Die Genannten werden bald alle selbst den Hass des Karl Marx und seine Zerstörungswut gegenüber ihrer erfolgreichen Organisation zu spüren bekommen. Mit der Kritik an Hermann Ewerbeck in Paris ging es ja schon los, als Weitling von Marx noch über den grünen Klee gelobt wurde.